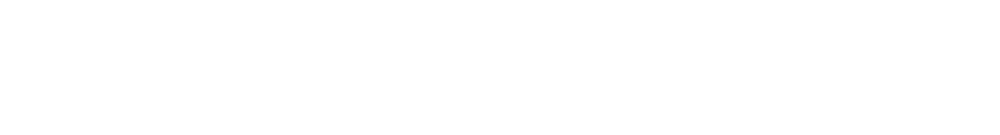Wenn Mauern zu eng werden
Wenn das Zuhause zu eng wird
Als ich wieder nach Hause kam, hatte ich dieses komische Gefühl, das ich vorher nicht kannte. Herbie stand da, vor meinem Haus, so wie immer. Nichts Besonderes. Und trotzdem war genau das der Moment, in dem mir klar wurde, dass ich nicht mehr derselbe bin, der vor ein paar Wochen losgefahren ist. Ich machte die Haustür auf und stand in meinem eigenen Haus — ein Haus, das ich eigentlich mag, weil es mein Zuhause sein sollte.
Ein Rückzugsort. Ein Platz, an dem man zur Ruhe kommt. Aber genau das passierte nicht. Ich trat rein und spürte sofort diese Schwere. Nicht emotional — körperlich. Als würde die Luft dicker werden. Als würde der Raum sich nicht öffnen, sondern enger ziehen. Jede Wand fühlte sich plötzlich so an, als würde sie mir näher kommen, als würde sie mich anschauen und fragen:
„Und? Bist du wirklich wieder da?“
Ich weiß nicht, wie man so was nennt, aber es hat sich angefühlt, als würde mein eigenes Haus mich erdrücken. Nicht aus Angst. Nicht aus Panik. Sondern weil diese Mauern aus Stein im Vergleich zu ein paar Millimetern Van-Blech einfach… zu viel waren.
Es war, als wäre das Haus zu laut, obwohl es still war. Die Räume zu groß, obwohl ich Platz mag. Zu stabil, zu statisch, zu schwer. Ich stand im Wohnzimmer, das eigentlich gemütlich ist, und dachte mir: Warum fühlt sich das alles falsch an? Warum fühle ich mich in meinem eigenen Bett fremder als in diesem engen Van? Warum halte ich es hier nicht aus? Und ich weiß, dass das nicht jeder verstehen wird.
Es gibt Menschen, die nach jeder Reise froh sind, endlich wieder daheim zu sein. Menschen, die aufatmen, sobald sie die eigenen vier Wände betreten. Menschen, für die „Heimkommen“ ein Gefühl ist. Das ist okay. Ich nehme es niemandem übel, wenn er das, was ich gerade schreibe, nicht nachempfinden kann. Denn ich war schon immer ein Explorer, ein Suchender. Manche brauchen Mauern, um sich sicher zu fühlen. Ich brauche sie gerade weniger denn je zuvor. Denn dieses Gefühl ist nicht einfach so entstanden. Es hat sich manifestiert, als ich draußen war — an der Küste, im Wind, im Licht, in dieser Rohheit der Natur. In dieser Freiheit, die so ehrlich ist, dass sie fast weh tut, wenn man sie zum ersten Mal wirklich spürt und sich ihr hingibt. Und jetzt, im Haus… fehlte das alles.
Ich merkte, wie schwer Mauern sein können, wenn man einmal erlebt hat, wie leicht Leben sich anfühlen kann. Wie eng ein Raum wird, wenn man weiß, wie unendlich ein Horizont aussieht. Wie fremd ein Zuhause wirken kann, wenn man sein echtes Zuhause vielleicht gerade erst gefunden hat — auf vier Rädern, irgendwo zwischen Meer und Stille.
Das Ziehen zurück in den Bulli
Nach ein paar Tagen merkte ich, dass dieses Gefühl nicht einfach wieder weggeht. Ich habe darauf gewartet. Ehrlich. Ich habe gedacht: „Gib dir Zeit, Dominik. Du brauchst nur ein bisschen, um wieder anzukommen.“
Aber ich kam nicht an.
Es war, als würde mein Körper in diesem Haus wohnen, aber mein Kopf und mein Herz standen irgendwo an einer Küstenstraße in Südfrankreich, mit Sand auf den Fußmatten und salziger Luft im Gesicht. Und dann begann dieses Ziehen. Leise zuerst. Fast unmerklich. So ein Gefühl, das irgendwo tief unten anfängt, so weit unten, dass du es am ersten Tag noch ignorierst. Und am zweiten vielleicht auch. Aber irgendwann wird es stärker. Es wird lauter. Es fängt an, in dir zu brennen.
Nicht schmerzhaft — eher wie ein unruhiges kleines Feuer, das dich nachts wach hält und tagsüber immer wieder daran erinnert, dass du gerade nicht da bist, wo du sein willst. Ich erwischte mich ständig dabei, wie ich aus dem Fenster schaute. Richtung Parkplatz. Richtung Bulli. Richtung Freiheit.
Und irgendwann, ohne groß nachzudenken, ohne Plan, ohne Drama, bin ich rausgegangen, habe die Tür vom Van geöffnet, mich reingesetzt – und es hat sich sofort richtig angefühlt. Kein großes Gefühl. Kein „Oh mein Gott, ich bin wieder zu Hause“. Einfach nur: Ruhe. So, als würde der Bulli sagen: „Komm, setz dich. Atme. Du musst nicht reden.“
Ich blieb erst nur für ein paar Minuten drin sitzen. Dann eine Stunde. Dann die erste Nacht. Ich hatte ein warmes Bett im Haus, weiche Kissen, eine richtige Matratze – aber ich wollte da nicht liegen. Ich wollte hinter diesem dünnen Blech schlafen, eingepackt zwischen Decke, Schlafsack und diesem vertrauten Geruch nach Freiheit, der im Haus nie existiert hat. Und ich weiß, auch das wird wieder jemand nicht verstehen.
„Wie kann man lieber in einem Auto schlafen als im eigenen Bett?“
Ja… weiß ich auch nicht. Aber mein Körper, anfänglich dachte ich es war auf meine Panikattacken zurückzuführen, wusste es. Im Bulli ist alles nah. Alles greifbar. Nichts ist zu groß, nichts ist zu weit weg. Du hörst den Regen anders. Den Wind anders. Die Nacht anders. Und irgendwann fragte ich mich nicht mehr, warum ich da draußen schlafe. Ich fragte mich nur noch, wie ich es so lange im Haus ausgehalten habe. Und dann wurde aus einer Nacht zwei. Aus zwei wurden vier. Und irgendwann war es so normal, dass ich gar nicht mehr erklären musste, warum ich wieder im Van schlafe, obwohl mein Haus nur ein paar Meter daneben steht.
Es war keine Flucht. Es war eher ein Zurückfinden. Ein Wiederankommen. An einem Ort, der viel kleiner ist als ein Haus – aber viel ehrlicher.
Optimieren, Scheitern, Lernen
Je länger ich zu Hause war, desto klarer wurde mir: Ein Van ist kein Auto. Ein Van ist ein Projekt. Und dieses Projekt hört nie auf. Man denkt ja anfangs wirklich, man kauft sich so ein Ding, schmeißt eine Matratze rein, einen Kocher, vielleicht eine Kiste für Kleidung — und dann fährt man los. So schön einfach. So herrlich naiv. Aber die Realität ist anders.
Die Realität ist, dass du beim Fahren irgendwann merkst, dass das Besteck immer so laut klappert, wo immer es auch gerade verstaut ist. Dass das Kabel, das du gestern noch irgendwohin geklemmt hast, heute schon ein Chaos ausgelöst hat. Dass deine „super clevere Idee“ vom letzten Ausbau plötzlich völlig unsinnig wirkt, nur weil der Alltag sie getestet hat. Es ist ein ständiges Lernen. Nicht theoretisch — praktisch. Mitten im Leben, mitten im Fahren, mitten im Alltag aus Regen, Sonne, Wind, Proviant, Schlafplatzsuche und diesem leisen Drang, es beim nächsten Mal besser zu machen. Ich glaube, erst auf diesen Reisen habe ich wirklich verstanden, wie viel man falsch planen kann. Und wie viel Zeug da draußen verkauft wird mit genau diesem Satz: „Das ist die perfekte Lösung für Camper.“ Nur um dann unterwegs zu merken, dass die Hälfte davon gar nichts taugt, außer im Prospekt gut auszusehen. Man denkt ja, man hätte alles im Griff, man hätte vorausgedacht, man hätte das Richtige gekauft — und dann stehst du im Alltag da und merkst, wie wenig du eigentlich vorausdenken kannst.
Wie sehr dir so ein kleiner Raum sofort jeden Fehler, jede falsche Entscheidung, jeder falsch verstaute Gegenstand direkt vor die Füße wirft. Und wie sehr dieses Leben auf engem Raum dir alles abverlangt, weil nichts versteckt bleiben kann. Nicht dein Chaos. Nicht deine Ungeduld. Nicht deine Fehlkäufe. Alles zeigt sich sofort. Ich denke oft an diesen Moment am Meer zurück — dieser Prospektmoment, den jeder kennt. Bus öffnet sich. Sonne scheint. Kaffee duftet.
Und man steht da mit dem Kocher, lächelt, macht sich etwas zu essen. In meinem Fall hat der Wind den kompletten Prospekt zerstört. Die Flamme war einfach weg. Nicht einmal kurz — einfach weg. Fünf Sekunden Kochen, zehn Sekunden Wind. Und irgendwann stand ich da, lachte über mich selbst und dachte: „Okay, wieder was gelernt.“ Das passiert ständig. Du fährst an Stränden, durch Berge, durch Städte und merkst: Was gestern funktionierte, funktioniert heute nicht mehr. Was du gestern für genial gehalten hast, nervt dich heute. Was du nicht brauchtest, brauchst du plötzlich jeden Tag.
Also fängt man an zu optimieren. Nicht weil man unzufrieden ist — sondern weil man merkt, wie sehr dieses Leben mit einem mitwächst. Man kauft neue Haken, neue Schubladen, neue Boxen. Man probiert Solarpanels aus, vergleicht Wattzahlen, Standorte, Ausrichtungen. Man überlegt, ob man Strom lieber vom Dach nimmt oder doch portable. Man testet Duschlösungen und merkt irgendwann, dass der Heizstab im Wassertank eine romantische Idee war — aber praktisch nicht funktioniert. Und genau das liebe ich daran. Dieses permanente „noch nicht fertig“. Dieses „da geht noch was“. Dieses „ich will es für die nächste Tour besser machen“.
Während der ganzen Zeit des Optimierens ist in mir ein ganz großer Traum, ein Ziel entstanden: Ich möchte mir gerne einen Van selber ausbauen. Aber leider bin ich handwerklich nicht unbedingt so begabt. Aber vielleicht bist du, der gerade diese Zeilen liest, derjenige, mit dem ich dieses Projekt zusammen starten kann. Ich würde mich freuen, wenn wir voneinander hören würden.
Und gleichzeitig ist es genau dieses Optimieren, das mich zu Hause halbwegs über Wasser hält. Während ich zwischen Mauern lebe, arbeite ich in Gedanken am nächsten Ausbau. Ich sitze in der Küche und vergleiche Ladezeiten von Powerstations. Ich liege im Bett und überlege, ob ich die Heckklappe anders organisieren kann. Ich surfe im Netz durch Messen, durch Foren, durch Videos — nicht weil ich konsumieren will, sondern weil ich wieder los will. Man könnte sagen: Ich optimiere meinen Van — aber eigentlich optimiere ich meine Freiheit. Und jedes einzelne Detail, das ich ändere, bringt mich innerlich einen Schritt näher an die nächste Abfahrt.
Die Freiheit, die etwas in mir verändert hat
Je länger ich draußen unterwegs war, desto klarer wurde mir, dass diese Freiheit nicht einfach nur ein „Urlaubsgefühl“ ist. Es war etwas anderes. Etwas, das tiefer ging, als ich es erwartet habe. Es ist schwer zu erklären, was genau da mit einem passiert. Vielleicht, weil es nicht in einem Moment entsteht, sondern Stück für Stück. So leise, dass man es zuerst gar nicht bemerkt. Aber irgendwann spürt man, dass sich etwas in einem verschoben hat. Ich habe unterwegs kein großes Ereignis gehabt, das alles verändert hätte. Keinen magischen Moment. Kein Hollywood-Licht. Es waren die vielen kleinen Dinge.
Der erste Morgen, an dem ich die Tür aufschob und die Luft roch anders. Nicht nach Straßen und Heizung — sondern nach Salz und Wind. Die Art, wie das Licht durch die Fenster viel weicher fällt, wenn nichts zwischen dir und der Sonne steht außer eine dünne Fensterscheibe in einem Van. Die Stille, die nachts über dem Meer hängt, wenn man nur den eigenen Atem hört. Oder das Rauschen der Wellen, das so gleichmäßig ist, dass es sich wie ein natürlicher Herzschlag anfühlt. Und irgendwann, ohne dass man es merkt, stellt sich eine Ruhe ein, die man im normalen Leben kaum findet. Nicht die Ruhe von „nichts tun“. Sondern diese besondere Ruhe, die entsteht, wenn man nichts spielt, nichts beweisen muss, nichts darstellt. Wenn man einfach nur ist.
Ich glaube, genau das hat in mir etwas ausgelöst. Diese Freiheit, dieses Draußensein, diese Nähe zur Natur — das ist ehrlich. Sie nimmt nichts weg, sie fordert nichts, sie bewertet nichts. Sie lässt dich so sein, wie du bist, ohne dass du dich verstecken musst. Und das verändert einen. Vielleicht nicht sofort. Aber Stück für Stück. Für mich war die Freiheit draußen so echt, so roh, so unverfälscht, dass ich sie nicht mehr einfach ablegen konnte wie eine Jacke. Sie hat sich in mir festgesetzt. Tiefer, als ich je gedacht hätte.
Ich habe im Van etwas gefunden, das ich im Haus nicht mehr spüre: Mich. Nicht die Version, die funktionieren muss. Nicht die Version, die Erwartungen erfüllt. Sondern die Version, die atmet. Die fühlt. Die lebt. Die frei ist von Depression und Panikstörung.
Und genau deswegen zieht es mich immer wieder raus. Weil ich draußen nicht jemand anders bin — sondern einfach ich.
Der Weg zu meinem nächsten Ziel (Spanien, Portugal, Marokko)
Je länger ich zu Hause war, desto stärker wurde dieses innere Brennen. Am Anfang war es nur so ein Gedanke, der kurz aufflackerte. So ein leises: „Vielleicht fahre ich nochmal runter.“ Ein Gedanke, der sich bei jedem Kaffee, jedem Blick aus dem Fenster, bei jeder alltäglichen Arbeit lauter meldete. Ich saß an meinem Küchentisch, hatte mein Handy in der Hand, wollte eigentlich Mails beantworten – und plötzlich ertappte ich mich dabei, wie ich Stellplätze in Südfrankreich googelte. Nur mal so. Nur zum Schauen. Aber aus „nur mal schauen“ wurde „nur mal vergleichen“. Aus Vergleichen wurde „nur mal die Route grob ansehen“. Und irgendwann war da kein „nur mal“ mehr. Irgendwann war da nur noch:
Ich muss wieder los.
Dieses Gefühl, das in mir brannte, war nicht unruhig oder verzweifelt. Es war eher so ein innerer Magnet. So ein Ziehen, das mir klar machte: Die Reise an die Côte d’Azur war nicht der Abschluss — sie war der Anfang. Und wenn ich ehrlich bin, fing in mir schon während der Rückfahrt aus Frankreich etwas an zu arbeiten. So leise, dass ich es da noch ignorieren konnte. Aber jetzt, zu Hause, wurde daraus ein Plan. Oder etwas, das sich zumindest wie ein Plan anfühlte. Ich wollte zurück an die Côte d’Azur. Noch einmal diesen Duft aus Meer und warmer Luft. Noch einmal dieses Licht sehen, das es nur dort gibt. Diese Mischung aus Leere und Freiheit, aus Einsamkeit und Frieden. Aber diesmal wollte ich nicht bleiben. Diesmal wollte ich weiter. Spanien. Portugal. Und wenn alles passt, vielleicht bis ganz runter – bis zur Grenze zu Marokko. Nur einmal stehen, da unten, mit Blick auf Afrika. Nicht, weil ich unbedingt dorthin musste. Sondern weil ich wissen wollte, wie es sich anfühlt, wenn das Leben plötzlich wirklich weit wird.
 Ich fing an, Karten zu vergleichen. Ich schaute mir Routen durch Nordspanien an. Las über Küstenstraßen in Portugal, über Strände, an denen man zwischen Fels und Meer schlafen kann. Und irgendwo dazwischen starrte ich lange auf Google Maps – auf diesen kleinen Punkt unten am südlichsten Rand Portugals.
Ich fing an, Karten zu vergleichen. Ich schaute mir Routen durch Nordspanien an. Las über Küstenstraßen in Portugal, über Strände, an denen man zwischen Fels und Meer schlafen kann. Und irgendwo dazwischen starrte ich lange auf Google Maps – auf diesen kleinen Punkt unten am südlichsten Rand Portugals.
Sagres. Cabo de São Vicente. Das „Ende der Welt“, wie man früher sagte. Und ich dachte mir: Wenn ich schon mal unterwegs bin… warum nicht bis dahin? Das Verrückte ist: Es war kein Abenteuerdrang. Keine Bucket-List. Kein „ich will unbedingt“. Es war eher ein Gefühl von: Da unten könnte etwas auf mich warten. Und ich will herausfinden, was. Während ich auf diese Karten schaute, merkte ich, dass sich mein innerer Zustand veränderte. Ich fühlte mich nicht mehr wie jemand, der von einer Reise zurück ist. Ich fühlte mich wie jemand, der zwischen zwei Reisen lebt. So, als wäre das Zuhause nicht mehr Anfang oder Ende – sondern nur eine kurze Zwischenstation, an der man den Motor checkt, Wasser auffüllt. Die Vorstellung, wieder loszufahren, gab mir etwas zurück, das ich im Haus nicht fand:
Hoffnung.
Vorfreude.
Leben.
Und als ich dann endlich zu mir und meiner Familie sagte: Ich fahre wieder runter.… fiel eine Last von mir, die ich bis dahin gar nicht richtig gespürt hatte. Es war, als würde jemand in mir ein Fenster öffnen. Luft. Licht. Freiheit.
Wohin es mich dann wirklich getragen hat – das ist eine eigene Geschichte. Eine, die größer wurde als jede Planung. Und eine, die ich dir im nächsten Kapitel erzähle.