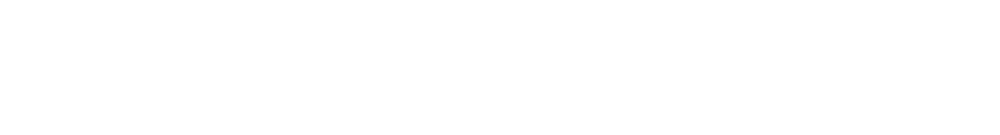Der Brief – Mein Start bei Condor
Der Brief
Er lag plötzlich da, als hätte ihn jemand vorsichtig in mein Jetzt gelegt, ohne zu fragen, ob ich bereit bin. Ein Umschlag, in dem die Luft anders roch. Ort, Datum, Uhrzeit. Und ein Ticket. Kein Versprechen, kein „Vielleicht irgendwann“ – ein echtes Ticket, das mich herausführte aus den Scherben dessen, was ich bis dahin „mein Leben“ genannt hatte.
Ich hatte mich nie für Bewerbungen interessiert – nicht aus Arroganz, sondern weil mein Weg immer anders funktioniert hat. Auf Papier war ich selten überzeugend: keine Mappen voller Zertifikate, keine sauber gestapelten Nachweise. Ich habe die meisten Dinge selbst aufgebaut, Verantwortung übernommen, Teams geführt, Probleme gelöst – nur eben nicht in Formularfeldern. Wenn mir Menschen die Chance gaben, mich persönlich vorzustellen, hat das fast immer den Unterschied gemacht. Ein Raum, ein Gespräch, ein Handschlag: Da konnte ich zeigen, wer ich bin, wofür ich stehe, und dass ich das, was anliegt, zuverlässig und erfolgreich ins Ziel bringe.
Umso überraschender war es, dass ich mich bei Condor wirklich bewarb – und noch überraschender, dass kurz darauf genau dieser Brief kam, mit einem Ticket darin. Ich hatte nicht damit gerechnet. Es fühlte sich an wie ein Licht, das plötzlich angeht, wenn man schon glaubt, den Schalter verlegt zu haben. Ein Griff nach meiner Hand, ja – aber auch die Erlaubnis, wieder ich selbst zu sein. In mir mischten sich zwei kräftige Ströme: die leise Angst vor dem Unbekannten und eine überwältigende, helle Freude. Beides durfte da sein. Und genau in diesem Doppelklang – Herzklopfen und Aufatmen – begann mein neuer Weg.
Frankfurt am Morgen
Ich war früh am Gate. Kein Stress, nur dieses wache Gefühl, wenn ein Tag etwas von dir will. Für die meisten ist Fliegen ein seltenes Ereignis – Urlaub, vielleicht einmal im Jahr. Kein Alltag. Genau so fühlte es sich an: ein eigener Planet mit Regeln, die man nicht im Schlaf kennt.
Die Hallen weit, das Licht klar. Ansagen rollten durch den Raum, Namen, Gate-Nummern, letzte Aufrufe. Rollkoffer klackten im Takt, irgendwo lachte eine Reisegruppe, die nach Sonnencreme roch. Mein Termin in Kelsterbach war auf 08:00 Uhr gesetzt; der eigentliche Test begann also vorher: rechtzeitig ankommen, den Weg finden, innerlich sortieren.
Ich folgte Pfeilen, nicht Gedanken. Einatmen, ausatmen, Schritt für Schritt. Keine großen Sätze – nur Richtung. Zwischen Anzeige und Ausgang wurde mir klar: Heute zählt nicht, was war. Heute zählt, dass ich ankomme.
Assessment – ein Marathon
Englischtest, Selbstvorstellung, noch ein Test, wieder warten. Ein Raum, der jeden Atemzug hörte. Ich kam mir vor wie in einem Marathon, der nicht auf Asphalt stattfindet, sondern im Kopf und im Körper zugleich. Vorher Unternehmer, Großkunden, Verantwortung. Jetzt Bewerber unter Neonlicht. Und doch war da etwas Unverhandelbares: Ich wollte hier sein.
Die Stationen zogen an mir vorbei wie Kilometermarken. Schriftliche Checks, in denen jede Minute zählte. Dann Gruppenaufgaben: Entscheidungen unter Zeitdruck, Szenarien, in denen man Prioritäten sortieren musste, während zehn Augenpaare gleichzeitig Führung erwarteten. Wir bauten Formen, ordneten Informationen, legten Strategien fest – nicht, weil es hübsch aussah, sondern weil man uns testen wollte: Wer hält den Kurs, wenn die Strecke zäh wird? Wer bleibt klar, wenn die Stimmen lauter werden?
Es gab diese psychologischen Spiele, die freundlich beginnen und plötzlich ernst werden: Wer übernimmt, ohne zu dominieren? Wer hört wirklich zu, bevor er spricht? Wer kann eine Richtung geben, wenn niemand sie kennt? Ich spürte meine Schultern, den Nacken, das Herz im Takt der Sekunden. Trinkpausen waren zu kurz, die Luft zu wach. Der Körper wollte sitzen, der Kopf musste weiter.
Zwischendurch wieder Stille auf den Stühlen, Kulis, die gleichzeitig klicken, ein Lächeln, das mehr Mut ist als Gefühl. Ich merkte, wie jede Aufgabe etwas von mir abtrug und zugleich etwas freilegt: Haltung unter Druck, Respekt in der Diskussion, Klarheit im nächsten kleinen Schritt. So fühlt sich ein langer Lauf an – nicht heroisch, sondern beharrlich.
Als ich am Abend nach Hause kam, war ich leer und weit zugleich. Fix und fertig, ja – aber nicht ausgebrannt. Eher durchgelaufen: müde Beine, wacher Blick. Dieser Tag war anstrengend, fordernd, fair. Und er war eine Tür.
Am Rand all dessen passierte etwas, das ich damals noch nicht einordnen konnte. Ich begegnete einem für mich sehr besonderen Menschen, der mein Leben – ohne dass ich es ahnte – bis heute verändern sollte: Melanie.
Start
Wieder die Glashäuser. Wieder dieser Raum, in dem Hoffnung Platz nimmt. Am ersten Morgen standen Stühle im Halbkreis, Namensschilder auf dem Tisch, Wasserflaschen, ein Stapel Skripte. Fremde Menschen, die noch keine Geschichte miteinander haben, aber dieselbe Richtung. Bunt gemischt: Quereinsteiger, Vielreisende, Neugierige, solche mit Flugsehnsucht und solche mit Neuanfang im Gepäck. Unser Kurs bekam eine Zahl – Lehrgang 144 – und plötzlich war aus „ich“ ein „wir“.
Das Trainerteam stellte sich vor: ruhig, klar, mit diesem Ton, der sagt „Wir kriegen das zusammen hin“. Dann begann es – ohne großes Warmreden. Ein Überblick: Was lernen wir? Wofür machen wir es? Wie sieht ein Tag an Bord aus, wenn alles normal läuft? Und was, wenn nicht?
Wir schoben die Stühle beiseite und bauten unseren ersten „kleinen Himmel“ im Raum. Service ist mehr als Tabletts und Lächeln, sagten sie, und dennoch fängt er genau dort an. Wir übten Handgriffe, die später selbstverständlich wirken sollen: Wagen aufrüsten, Bremsen sichern, Trolleys aus der Galley ziehen, Inventar prüfen. Wo liegt was? Was ist versiegelt? Welche Produkte sind „Duty Free“, was ist inklusive? Wie spricht man Menschen an, die müde sind, ängstlich, hungrig, genervt oder einfach nur da?
Ansagen. Wir probten die Worte, die man sonst nur hört: Begrüßung, Sicherheitsdemonstration, Informationen bei Verzögerung. Nicht runterleiern – tragen. So, dass selbst jener Satz mit Leben gefüllt bleibt, den man schon hundertmal gesagt hat: „Guten Morgen, meine Damen und Herren, willkommen an Bord…“ Der Raum wurde zur Kabine, die Kabine zur Bühne, und wir merkten: Es geht nicht um Show. Es geht um Klarheit.
Ablaufkunde. Wir gingen den Flug wie einen Fluss ab: Boarding, Türen zu, Pushback, Servicefenster, Sondermahlzeiten, Sonderwünsche, Abfalllogik, Nachbestückung. Wer macht wann was? Wer fragt, wer entscheidet? Kleine Szenen, immer wieder neu: ein Kind mit Ohrenschmerzen, ein Passagier, der sitzen bleiben will, wenn alle stehen, die Frage nach Tomatensaft und die Antwort darauf, warum er hier anders schmeckt.
Zwischendurch lachten wir. Lernlachen, das, was entsteht, wenn man sich in etwas Unbekanntes hineinstellt und merkt: Es trägt. Fremde bewegten sich ineinander ein wie Puzzleteile, die anfangs nicht passten und dann plötzlich Halt finden. Wir lernten, einander Blicke zuzuwerfen, die mehr sagen als Worte, Hände zu benutzen, die leise sprechen: „Ich hab’s, du weiter da.“
Am Ende des Tages stand nicht nur Stoff auf dem Papier, sondern Haltung im Raum. Lehrgang 144 fühlte sich an wie ein Versprechen, das man gemeinsam unterschreibt. Und ja – in 144 war auch Melanie.
Melanie
Diesen Abschnitt widme ich dir, Mel. Seit über 25 Jahren bist du nicht nur Teil dieser Geschichte, sondern Teil meiner Familie – und ich deiner. Was wir damals in Lehrgang 144 begonnen haben, ist viel mehr als ein gemeinsamer Kurs gewesen. Es war der Anfang von etwas, das trägt, wenn’s still wird, und lacht, wenn’s zu ernst wird.
Ich sehe uns noch jeden Morgen: dein „spitzenmäßiger“ BMW, der schon vor der Haustür brummte, als wollte er sagen: „Komm, wir schaffen das.“ Ich öffne die Tür – und diese erste, beißende Rauchwolke, die mir entgegenschlug. Ich wedelte halb dramatisch, halb lachend mit der Hand, dir rutschte das freundlichste „Dahmen’l“ der Welt raus, und genau da begann unser Tag. Es war unser Ritual: ein bisschen motzen, sehr viel lachen, losfahren.
Und dann verfahren. Immer wieder. 27 Mal in 90 Tagen – auf exakt derselben Strecke. Es fühlte sich an, als würde sich Kelsterbach jeden Morgen versetzen lassen – mal hier, mal dort, nie da, wo wir es erwartet hätten. Mel fuhr los, wir diskutierten über „gleich da vorne abbiegen“, und plötzlich war „gleich da vorne“ schon wieder woanders. Die Schilder zeigten uns etwas anderes, und wir sagten: „Okay, wir probieren’s.“ Dann lachten wir. Nicht über Mel, sondern ich lachte mit ihr. Weil diese Fahrten zur Condor-Ausbildung unser kleines Abenteuer wurden: falsche Einfahrt, neue Runde, nächster Versuch. Und immer dieses befreiende Lachen im Auto, das sagte: Wir finden den Weg. Wir finden ihn zusammen.
Ich erinnere mich an Abende, die zu Nächten wurden. Wir saßen in irgendeinem kleinen Lokal, mit einem Glas Wein und einer Cola Light. Und wir redeten, lernten, sortierten, dachten laut – so lange, bis die Cola Light in Zeitlupe verschwand und am Ende eher Sirup war als Getränk. Das wurde unser Maßstab: „Wie dick ist die Cola heute?“ Je zäher sie wurde, desto klarer wurden wir. Und wenn wir dann in die kühle Luft traten, war die Welt leichter, sogar die Prüfungspläne.
Wir standen oft auf der Aussichtsplattform des Terminals, still nebeneinander. Flugzeuge rollten, hoben ab, kamen an. Wir schauten ihnen nach, als würden sie uns eine Richtung zeigen, die wir noch nicht ganz kannten, aber fühlten. In diesen Momenten habe ich verstanden, was wir einander sind: jemand, der bleibt. Jemand, der die Hand nicht loslässt, wenn der Wind dreht.
Dass wir gefühlt Tag und Nacht zusammen waren, fiel auf – natürlich. Fragen standen im Raum, leise Zweifel von außen. Und dann kam dieser Tag, an dem ich deiner Familie vorgestellt wurde. Keine Prüfung, kein Test. Nur Türen, die sich öffnen. Ich wurde warm, selbstverständlich, ohne Bedingungen aufgenommen – als wäre ich schon immer da gewesen. Seitdem weiß ich: Heimat ist nicht nur ein Ort. Heimat sind Menschen, die „Komm rein“ sagen, wenn du an der Schwelle stehst.
Heute leben wir viel zu weit voneinander entfernt. Das macht mich manchmal traurig – so eine weiche, stille Traurigkeit. Aber sie hat keine Macht über das, was wir sind. Wir sehen uns selten, und doch bist du da, und ich bei dir. In Anrufen, in Erinnerungen, in Sätzen, die wir schon zu Ende hören, bevor sie gesprochen sind. Wir sind Familie – ohne Fußnoten.
Du hast meine Ecken ausgehalten, mich in Bewegung gebracht, wenn ich festhing, und mich gebremst, wenn ich rannte. Du hast mich – ohne große Worte – gelehrt, dass Nähe nicht laut sein muss, um stark zu sein. Und wenn ich heute schreibe, dass ein Brief der Anfang war, dann gehört dazu, dass du der Grund bist, warum ich diesen Weg wirklich gehen konnte.
Danke, Mel. Für Zigarettenrauch im Morgenlicht, für falsche Abbieger, die zu richtigen Ankünften wurden, für Cola, die zu Sirup reifte, während wir besser wurden, für Lachen, das Tränen kennt, und für ein Zuhause, das „wir“ heißt.
Danke von Herzen.
Flight Safety – Frank

Frank hatte eine Stimme, die nicht laut werden musste, um ernst zu sein. Er ließ uns üben, bis der Körper schneller reagierte als die Angst: Feuer im Simulator, Rauch, „Dangerous Goods“, Deeskalation, Fesseln, klare Worte, klare Handgriffe. Kein Spektakel, sondern Realismus. Und doch: Mitten in all der Strenge konnte er uns zum Lachen bringen, ohne die Bedeutung zu verwässern. Einmal setzte Mel die Rauchschutzhaube auf – Zulassung: zehn Minuten. Frank ließ sie fünfunddreißig laufen. Wir beobachteten, wie ihr Gesicht unter der Haube erst rosig, dann leicht grün wurde, und während wir schon Tränen lachten, blieb sein Blick ruhig: „Merkt euch den Druck. Merkt euch die Zeit. Und merkt euch, dass ihr es könnt.“ Das war Frank: Er führte uns vom einen Extrem ins andere – immer sicher, immer klar – und am Ende stand nicht Panik, sondern Widerstandskraft.
Manchmal vergesse ich, wie früh all das war. Aber heute genügt ein fremder Geruch im Gang, ein Ton in der Kabine, und mein Kopf greift wie von selbst ins Regal der Handlungen: Was ist das? Was ist mein erster Schritt? Diese Ruhe in lauten Sekunden hat uns Frank geschenkt. Sie sitzt tief, fast wie ein Muskel, der nie mehr ganz loslässt.
Es gab Tage, an denen der Simulator zur kleinen Welt wurde, in der alles passiert. Während einer Übung sollten wir den Evakuierungsbefehl laut und deutlich geben: „Gurte los, Schuhe aus, alles liegen lassen – raus!“ Eine Teilnehmerin setzte an – und plötzlich fühlte es sich an, als stünde ein Ausbilder aus einem dieser legendären Härtetrainings vor uns. Ihre Stimme fuhr durch den Simulator wie ein Startschuss; für einen Augenblick vibrierte der Raum, und die Schuhe hätten auch von allein fliegen können. Wir waren schneller draußen, als das Drehbuch es je vorgesehen hätte – erst erschrocken, dann prustend vor Lachen. Humor, der Spannung löst, ohne den Ernst zu verlieren.
Wir lachten viel, ja, aber die Ernsthaftigkeit blieb der Grundton. Frank ließ Raum für Humor, damit das Lernen in uns andockt – nicht, um die Gefahr kleinzureden, sondern damit wir ihr aufrecht begegnen können.
Werftluft und die Rutsche
Wir durften in die Werft zur 767 – dem Arbeitstier jener Zeit. Metall, das Geschichten erzählt. Nietenreihen wie Zeilen, die von Halt handeln. Wir standen am Overwing-Exit, sahen Mechanik, die verlässlich klingt, wenn alles andere laut ist. Dann die Übung: Slide scharfmachen, den Blick kurz sammeln, hinab. Kein Spaß-Event, sondern Begreifen im Körper: Wenn es ernst wird, ist Routine Gold.
Zwischen Hydraulikgeruch und kaltem Hangarlicht verstanden wir, warum diese Schultern das tragen können, wofür die Uniform steht. Nicht wegen der Ansagen. Wegen der Haltung. Und irgendwo in der Mischung aus Konzentration und Gelächter, aus „nochmal von vorn“ und „jetzt sitzt es“, wurde uns klar: Wir waren nicht nur dabei, etwas zu lernen. Wir waren dabei, anders zu werden.
Seenot
Im Schwimmbad wurde gelacht, geschluckt, gezählt, dirigiert. Wasser hat eine eigene Logik, und Rettung auch. Bei Condor, einem Ferienflieger zu den Sonnenzielen, klingt „Seenot“ erst einmal weit weg. Und doch gehört sie zu unserer Realität: Sobald ein Flug mehr als rund 90 nautische Meilen übers Wasser führt, zeigen wir die Schwimmwesten in der Sicherheitsvorführung. Nicht, weil wir jemanden erschrecken wollen, sondern weil es das Gesetz ist – und weil es Ditching gibt: die Notlandung auf Wasser. Dafür gibt es Handling-Procedures – Abläufe, Checklisten, Routinen. Dinge, die man so oft einübt, bis sie aus den Händen kommen, wenn der Kopf zu laut ist.
Der Trainingstag im Lufthansa-Ausbildungszentrum roch nach Chlor und kaltem Metall. Frank war da, natürlich. Neben ihm eine Trainerin, die das Lächeln nur dann verließ, wenn sie „Noch einmal“ sagte. Wir schoben die Theorie an den Beckenrand und sprangen ins kalte Wasser – nicht sinnbildlich, sondern buchstäblich. Frank machte aus dem Szenario keine Übung, sondern eine kleine Welt: Ditching wie im Drehbuch der Wirklichkeit.
Erst der Sprung. Das erste Brennen auf der Haut. Dann der Ruf, die Ordnung in der Unordnung: „Auf Linie! Zählen! Ruhe!“ Wir lösten die Rutsche, trennten sie wie geübt vom „Flugzeug“, machten aus ihr das, was sie in der Not ist: Rettungsinsel. Wir kletterten hinein, zogen andere nach, schufen Sitzordnung, gaben klare Anweisungen: Westen checken, Leinen sichern, Signalmittel bereit. Die Luft schmeckte nach Adrenalin und Beckenrand.
Frank ließ uns keine Abkürzung. „Wetter kommt nicht immer in Postkartenfarben“, sagte er – und griff zum Feuerwehrschlauch. Ein Strahl eiskalten Grundwassers peitschte über die Insel. Wir hielten Planen, gaben Kommandos, zogen an Leinen, hielten uns fest. Für Sekunden war das Schwimmbad kein Schwimmbad mehr, sondern ein grauer, bewegter Tag auf offener See. Wir froren, wir fluchten, wir funktionierten – und zwischendurch lachten wir, weil Humor die Muskeln wärmt, die man nicht sieht.
Zwischen all dem Lärm passierte das Eigentliche: Führung. Nicht brüllen. Leiten. Stimme tief, Sätze kurz, Blick wach. „Du hier. Du dort. Ich zähle. Wir bleiben zusammen.“ Es war nicht heroisch. Es war klar. Genau diese Klarheit nimmt der Angst den ersten Schritt.
Als wir später am Beckenrand saßen – nass, schwer, erschöpft – lagen neben uns die Dinge, die am Ende zählen: Routine, die trägt. Team, das sich wortlos sortiert. Und ein stilles Wissen: Wenn es je darauf ankäme, wären wir nicht perfekt, aber bereit. Frank nickte. Kein großer Applaus. Nur dieses eine Gefühl, das bleibt, wenn der Tag seinen Ernst gezeigt hat: Wir können das. Zusammen.
Zum Schluss
Das war nur ein Stück der Geschichte – ein Atemzug der Grundausbildung, kein Punkt. Ich nehme dich weiter mit: dorthin, wo Routinen zu Haltung werden, wo Lachen und Ernst nebeneinander Platz finden und ein neuer Teil von mir über den Wolken entsteht. Wenn dich das berührt hat, bleib dran – das nächste Kapitel folgt: erste Flüge, der Rhythmus über den Wolken, und noch mehr vom „Warum“ hinter jedem Handgriff. Du kannst weiterlesen oder dir die Geschichte im Podcast anhören – dasselbe Herz, nur in einer anderen Stimme.
Ich freue mich, dass du wieder dabei bist.